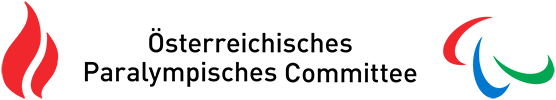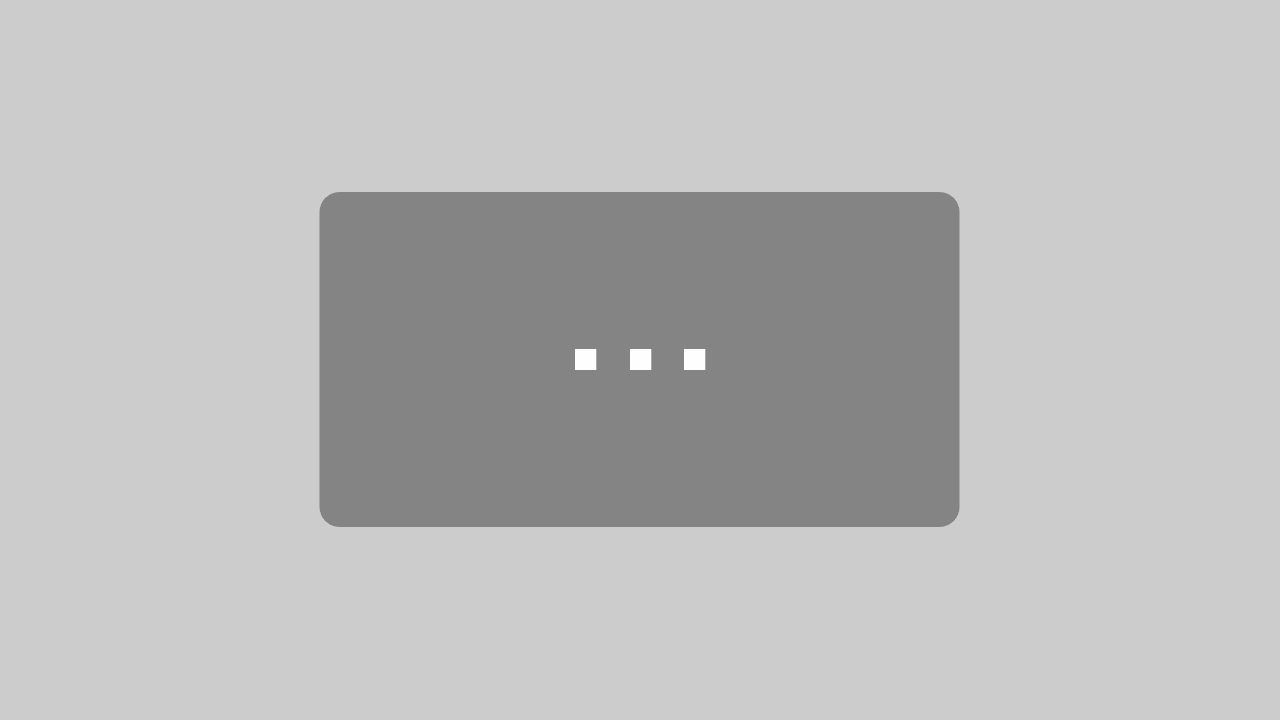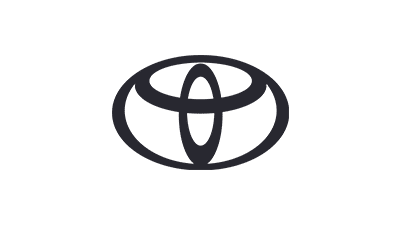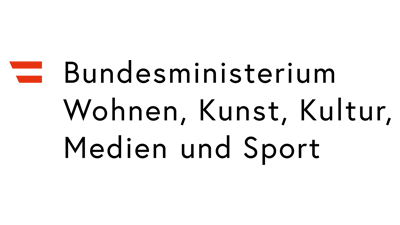Rollstuhl-Basketball
Rollstuhl-Basketball

Erstmalig als Turnier bei den Paralympics in ROM 1960 durchgeführt, ist Rollstuhl-Basketball eine der populärsten Sportarten der Paralympischen Spiele.
Spielberechtigt sind Damen und Herren und jedes Team besteht aus fünf Spieler:innen. Abhängig vom Grad der Behinderung erhält jede/r SpielerIn Punkte von 1,0 (schwerste Behinderung) bis 4,5 (leichte Behinderung). Die Gesamtpunkteanzahl eines Teams auf dem Spielfeld darf 14 nicht übersteigen.
Die Größe des Spielfelds, die Höhe der Körbe und die Regeln sind gleich wie im Basketball für Sportler:innen ohne Behinderung. Es gibt aber ein paar rollstuhlspezifische Anpassungen:

Radfahren ist seit den Spielen in SEOUL 1988 eine paralympische Disziplin. Die Sportart wurde als erstes von Athlet:innen mit Sehbeeinträchtigung betrieben, die die Wettkämpfe auf einem Tandembike mit einem Guide bestritten.
Derzeit nehmen zusätzlich zu den Athlet:innen mit Sehbeeinträchtigung auch Radfahrer:innen mit Cerebalparese, mit Amputationen sowie Rollstuhlfahrer:innen teil. Wettkämpfe gibt es auf dem Fahrrad, Dreirad, Handbike und dem Tandem.
Abhängig von der körperlichen Beeinträchtigung treten Athlet:innen auf einem Fahrrad, Dreirad, Tandem oder Handbike an. Je niedriger die Ziffer der jew. Klasse des/der AthletIn, umso höher ist die Auswirkung der Behinderung auf seine/ihre Fähigkeit zu fahren.
Dribbling
Beim Dribbling darf man abwechselnd Schieben und Prellen. Beim Schieben muss der Ball am Schoß liegen und nach maximal zwei Anschüben muss der Ball erneut geprellt werden.

© Allianz

© Allianz
Lifting
Die Athlet:innen dürfen sich nicht aus dem Rollstuhl stemmen, so dass das Gesäß die Sitzfläche des Rollstuhls verlässt, wenn dies einen Vorteil für den/die SpielerIn brächte.
Zylinderprinzip
Alle Spieler:innen umgibt ein imaginärer Zylinder, in den die Gegner:innen nicht eindringen dürfen, falls dadurch ein Vorteil entstünde.

© Allianz
Besonderheiten

© Allianz
Dribbling
Beim Dribbling darf man abwechselnd Schieben und Prellen. Beim Schieben muss der Ball am Schoß liegen und nach maximal zwei Anschüben muss der Ball erneut geprellt werden.

© Allianz
Lifting
Die Athlet:innen dürfen sich nicht aus dem Rollstuhl stemmen, so dass das Gesäß die Sitzfläche des Rollstuhls verlässt, wenn dies einen Vorteil für den/die SpielerIn brächte.

© Allianz
Zylinderprinzip
Alle Spieler:innen umgibt ein imaginärer Zylinder, in den die Gegner:innen nicht eindringen dürfen, falls dadurch ein Vorteil entstünde.
Bewerbe
TEAM-TURNIER
Damen – Herren
Verwaltung
• International
Internationaler Rollstuhl-Basketball Verband (IWBF-International Wheelchair Basketball Federation)
• National
Klassifizierung
Das Punktesystem richtet sich nach den funktionellen Einschränkungen in Bezug auf die Ausübung rollstuhlbasketballspezifischer Fertigkeiten, wie Kontrollieren des Balles, Passen, Werfen, Rebounden und Dribbeln sowie Starten, Schieben und Lenken des Rollstuhls.
Klasse 1 / 1,0 Punkte
Spieler:innen können die Beine nicht bewegen und nur geringe oder gar keine Rumpfkontrolle ausüben.
Die Sitzbalance ist sowohl vorwärts als auch seitwärts deutlich beeinträchtigt und sie benutzen die Arme, um in eine aufrechte Position zurückzukehren, wenn sie die Balance verloren haben.
Diese Spieler:innen verlieren bei geringfügigem Rollstuhlkontakt die Rumpfkontrolle und rebounden in der Regel über dem Kopf mit nur einer Hand, während die andere Hand zur Stabilität des Rollstuhls eingesetzt wird.
Beispiele: TH1–TH7 Paraplegie ohne Muskelkontrolle über dem Unterleib. Polio mit Einschluss der Arme und ohne Kontrolle der Rumpfmuskulatur.
Klasse 2 / 2,0 Punkte
Spieler:innen besitzen in der Regel keine Beinfunktion, haben aber teilweise eine Rumpfkontrolle nach vorne.
Sie verfügen über keine Seit- und Vorwärtsbewegungen. Eine Rotation mit dem oberen Rumpf ist möglich.
Sie besitzen begrenzte Sitzstabilität in Kontaktsituationen, dabei greifen oft die Hände an den Rollstuhl oder die Oberschenkel, um bei Kollisionen aufrecht zu bleiben. Beidhändiger Rebound über dem Kopf ist möglich.
Beispiele: TH8–L1 Paraplegie, Polio ohne Kontrolle der unteren Extremitäten.
Klasse 3 / 3,0 Punkte
Spieler:innen verfügen über gewisse Beinfunktionen und über eine gute bis ausgezeichnete Rumpfstabilität beim Beugen nach vorne bis zum Boden, beim Aufrichten sowie etwas Rumpftorsion.
Diese Spieler:innen haben keine gute Rumpfstabilität zur Seite, sie sitzen jedoch relativ stabil in Kontaktsituationen und können ohne Mühe mit beiden Händen über dem Kopf rebounden.
Beispiele: L2–L4 Paraplegie mit Kontrolle der Hüftbeugung und Zusammendrücken der Knie ohne Kontrolle der Hüftstreckung oder Spreizung. Polio mit minimaler Kontrolle der unteren Extremitäten.
Klasse 4 / 4,0 Punkte
Spieler:innen besitzen normale Rumpffunktionen, aber aufgrund von gewissen Schwächen in den Beinfunktionen sind sie nicht in der Lage, nach beiden Seiten in gleicher Weise kontrollierte Rumpfbewegungen auszuführen.
Sie verfügen über Stabilität beim Rollstuhlkontakt und können sich beim Rebound über dem Kopf mit beiden Händen nach vorne und komplett zu einer Seite lehnen, mit normalen Vorwärts-Torsionsbewegungen.
Beispiele: L5–S1 Paraplegie mit Kontrolle der Hüftabspreizung und völlige Streckbewegung auf einer Seite. Polio mit einem betroffenen Bein oder einseitig Oberschenkelamputierte.
Klasse 4,5 / 4,5 Punkte
Spieler:innen haben die geringste Behinderung auf dem Spielfeld. Normale, kraftvolle Rumpfbewegungen in alle Richtungen sind möglich und sie sind stabil in allen Kontaktsituationen.
Die Spieler:innen können sich mit den Armen über dem Kopf zum Rebounden in alle Richtungen bewegen. Der Rollstuhl kann mit maximaler Vorwärtsbewegung des Rumpfes stark beschleunigt und angetrieben bzw. gestoppt werden.
Spieler:innen können Richtungswechsel auch anhand von Rumpfdrehungen vornehmen ohne während des Dribblings die Stabilität zu verlieren. Der Rollstuhl hat eine niedrige Rückenlehne, die die volle Rumpfrotation zulässt.
Beispiele: einseitig Unter-Knie-Amputierte, einige doppelt Unter-Knie-Amputierte. Polio mit minimalen Einschränkungen (Knöchel oder Fuß) auf einer oder beiden Seiten. Spieler:innen mit funktionellen Einschränkungen der Hüft-, Knie- oder Sprunggelenke und Sportler:innen mit Minimalbehinderung.
VIDEOS
Office
Adalbert-Stifter-Straße 65
1200 Wien
ANRUFEN
Telefon: +43 5 9393 20330
Telefax: +43 5 9393 20334
E-Mail: office@oepc.at